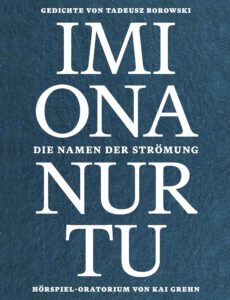
IMIONA NURTU. DIE NAMEN DER STRÖMUNG
Ein Hörspiel-Oratorium
unter Verwendung der Sterbebücher von Auschwitz und von Gedichten von Tadeusz Borowski
Übersetzung der Gedichte aus dem Polnischen: Kai Grehn & Aleksandra Ambrozy
Mit: Alexander Fehling, Rafael Stachowiak, Besucherinnen und Besuchern der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau & Menschen aus ganz Europa
Geräuschaufnahmen in den Häftlingsbaracken des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz II-Birkenau: Jean Szymczak & Kai Grehn
Wortaufnahmen: Martin Seelig & Jean Szymczak
Ton & Technik: Jean Szymczak
Produktions- und Regieassistenz: Julia Weinreich
Länge: 82:08 min
Dramaturgie: Manfred Hess, Pia Frede
Regie: Kai Grehn
Produktion: Südwestrundfunks in Kooperation mit dem Deutschlandfunk 2025
Hörspiel-CD + Buch mit einer zweisprachigen Auswahl an Gedichten von Tadeusz Borowski in der Übersetzung von Kai Grehn und Aleksandra Ambrozy bei Zweitausendeins / Major Label 2026 | 22,00 Euro | ISBN 978-3-96318-181-8
Die Produktion und Veröffentlichung des Hörspiel-Oratoriums wurde unterstützt und gefördert durch die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, die A und A Kulturstiftung, die Berthold Leibinger Stiftung und die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft.
TADEUSZ BOROWSKI: Alles entschwunden wie auf einer Bühne. Die Toten schweigen für immer,
und wir – die Lebenden – wie erheben wir die Stimme, wenn das Herz in Flammen steht?
Langsam vergehen die Stunden, und die Tage zählen für Jahrhunderte
und wie eine Steinplatte auf unserer Brust lastet die Freiheit.
Jemandem, der nicht mehr für sich selbst sprechen kann, die eigene Stimme zu leihen, ist ein fast intimes Ereignis. Für „Imiona nurtu. Die Namen der Strömung“ sind Menschen aus ganz Europa dem Aufruf von Kai Grehn gefolgt und haben aus den Sterbebüchern von Auschwitz die Namen von Ermordeten ausgewählt und eingesprochen. Entstanden ist ein memento mori, verwoben mit Lagergedichten des KZ-Überlebenden Tadeusz Borowski und mit Geräuschaufnahmen aus den ehemaligen Häftlingsbaracken, ein Hörspiel-Oratorium, das Brücken schlägt ins Hier und Heute.
„Imiona nurtu. Die Namen der Strömung“ wird als Soundinstallation auch in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau zu hören sein.
Alexander Fehling hat für „Imiona nurtu. Die Namen der Strömung“ Gedichte von Tadeusz Borowski gesprochen. Im Interview mit Pia Frede erzählt er, wie es zu der Zusammenarbeit mit Kai Grehn für dieses Stück kam:
Wenn ich mich richtig erinnere, hatten Kai Grehn und ich gerade die Arbeit an „The Sick Bag Song“, einem Hörstück nach Texten von Nick Cave hinter uns, als er mich anrief und sagte, er hätte da ein neues Projekt und es sei schwierig. Das hat mich natürlich interessiert. Als ich mich dann mit Borowskis Gedichten beschäftigt habe, war ich erschüttert von der Kraft dieser Texte. Das passiert manchmal, dass man da rein will in diese Sätze und Bilder oder dass man glaubt, jemanden zu verstehen. Wobei ich nicht die Zeit in Birkenau meine, auf keinen Fall, sondern die Stimme mit der Borowski spricht. Auch die kenne ich natürlich nicht, aber ich bilde mir dann ein, sie zu hören.
Wie gestaltete sich dann der Prozess, gemeinsam mit Kai Grehn herauszuarbeiten, wie die Gedichte vortragen werden können?
Das war tatsächlich nicht einfach. Es ist immer ein ganz schmaler Grat auf dem Gedichte anfangen zu klingen. Und hier ganz besonders, wegen des unfassbaren Alptraums von dem sie erzählen. Wobei man sagen muss, dass es dahinter eben auch um vieles andere geht. Nämlich wie ein extrem sensibler junger Mann seine Umwelt wahrnimmt; wovon er träumt, wenn er die Augen schließt; wo er sich Trost erhofft, was ihm heilig ist oder was er in sich selbst findet, wenn es draußen nichts mehr zu suchen gibt. Ich habe im Studio wie immer einfach ausprobiert und mich 100-prozentig auf Kais Ohr verlassen. Dabei wurde das Wort „Strömung“ für mich eigentlich zum entscheidenden Begriff. Ich wollte die Gedichte nicht vortragen oder interpretieren, sondern sie durch mich durchströmen lassen und versuchen, ihren ganz besonderen Klang zu bewahren.
Können Sie beschreiben, wie Sie das Hören der fertiggestellten Produktion erlebt haben?
Es geht mir äußerst selten so, eigentlich nie, aber: ich war fasziniert, von der grausamen Schönheit dieser Arbeit.
Graphikdesign des Hörbuchs von Andreas Töpfer
SCHWEIGEN IST KEINE OPTION
„Das ist das Ansinnen von „Imiona nurtu. Die Namen der Strömung“: das Vergessen verhindern und dem Schrecklichen dabei so nahe wie möglich kommen. Deshalb die Texte von Tadeusz Borowski, dem Augenzeugen, dem Schicksalsgenossen, niedergeschrieben noch im Zustand des unmittelbar Erlebten. Nicht bereits vielfach reflektierte Erinnerung, sondern noch nach einer Sprache suchend. All die künstlerischen Zugriffe dieses Hörspiels haben einen dienenden Charakter. Hier findet kein ritualisiertes, eingeübtes Gedenken statt.“
(Stefan Fischer, Süddeutsche Zeitung, 02.10.2025)
„»Imiona nurtu« ist ein außergewöhnliches Hörstück, das weit über die Grenzen des Genres hinausgeht. Es ist Kunst im Dienst des Erinnerns, ein Werk, das nicht erzählt, sondern Zeugnis ablegt. Kai Grehn gelingt ein stilles, fast rituelles Werk, das aus den Stimmen der Lebenden eine Brücke zu den Toten schlägt. Es zwingt zur Auseinandersetzung, zur Stille, zum Hinhören. Was bleibt, ist kein Trost, sondern ein Bewusstsein: dass Sprache Erinnerung trägt – und dass jeder Name, der gesprochen wird, für einen Moment das Schweigen überwindet.“
(hörspieltalk.de, 07.10.2025)
„Grehn gelingt es, das Verhältnis zwischen den Sprechenden und Lebenden, den Toten und Schweigenden zum Schwingen zu bringen. Wir hören Kinder und Jugendliche, Frauen und Männer, jung und alt, mit Dialekteinfärbungen, auf Englisch oder Polnisch, Niederländisch, Hebräisch oder Italienisch: So könnten auch die Stimmen derjenigen geklungen haben, deren Namen verlesen werden. Diese Lesenden, Lebenden sind Echos und Spiegel, sind Beteiligte. Borowski überlebte Auschwitz und Dachau, doch 1951 setzte der erst 28-Jährige seinem Leben selbst ein Ende. „Ich griff nach dem Tod wie nach einem Buch; vergiss das nicht“, spricht Alexander Fehling. Auch das: Mahnung und Trost, und sie fließen ineinander.“
(Cosima Lutz, epd medien, 12. Oktober 2025)
„Nach Auschwitz Gedichte zu schreiben, sei barbarisch, meinte Theodor W. Adorno einst. Der Philosoph wusste jedoch nichts von den Gedichten des polnischen Auschwitz-Überlebenden Tadeusz Borowski, bereits 1945 unter dem Titel „Imiona nurtu“ veröffentlicht. Kai Grehn verbindet seine eindringliche Lyrik mit Auszügen aus den Sterbebüchern von Auschwitz zu einem bemerkenswerten Hörspieloratorium.“
(Jah, Welt am Sonntag, 25.01.2026)
„Tadeusz Borowski, der drei Lager überlebte und sich 1951 mit 28 Jahren das Leben nahm, gehörte zu den ersten, die versuchten, das Grauen von Auschwitz literarisch zu verarbeiten – und schockierte das polnische Publikum. Der Schauspieler Alexander Fehling interpretiert die grauenhafte Kraft der Worte mit einem klugen Ton nachdenklicher Erschöpfung. Wie viel Gefühl ist gerade noch tragbar? Welche Geschichten geben wir unseren Kindern weiter? Was treibt zum Weiter-Existieren in Auschwitz? Borowskis erschütternde lyrische Bilder, die auch uns ins Herz treffen, unsere Gegenwart spiegeln können – unterbrechen den Strom der vorgetragenen Opfernamen.“
(Kirsten Böttcher, Bayern2, 02.02.2026)
„Das Hörspiel-Oratorium „Imiona nurtu. Die Namen der Strömung“ ist ein Projekt, das seinesgleichen sucht. Eine eigene Form. Menschen aus ganz Europa sprechen die Namen und Geburtsdaten von in Auschwitz Ermordeten. Verwoben mit Lagergedichten des KZ Überlebenden Tadeusz Borowski, im Hintergrund der Wind der Häftlingsbaracken. Daraus entsteht ein Memento mori, das die Hörenden in eine fast meditative Stimmung gleiten lässt. Jeder Name ein Menschenleben. Manchmal blitzt eine Assoziation auf zu Geburtsjahr und -Ort. Was für ein Werk. Wir wollen es auf diesem Wege würdigen.“
(Lobende Erwähnung – HdM Dezember 2025)
Mit Dank an die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, das Zentrum für Dialog und Gebet in Oświęcim und die Internationale Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim. Mit Dank an die A und A Kulturstiftung, die Berthold Leibinger Stiftung, die Maximilian-Kolbe-Stiftung und die Hans-Flesch-Gesellschaft. Mit Dank an das Burgtheater Wien, das Deutsche Theater Berlin, das Divadlo F.X. Šaldy Liberec, das Düsseldorfer Schauspielhaus, das Gólem Theater Budapest, das Hessische Staatstheater Wiesbaden, das Jerusalem Khan Theatre, das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin, das Narodowy Stary Teatr Kraków, das Národní divadlo Brno, das Nationaltheater Mannheim, das Niedersächsische Staatstheater Hannover, die Schaubühne Berlin, das Schauspiel Frankfurt am Main, das Schauspiel Leipzig, das Schauspielhaus Bochum, das Schauspielhaus Wien, das Staatsschauspiel Dresden, das Theater Basel, das Theater Lübeck, das Thüringer Landestheater Rudolstadt und die Volksbühne Berlin. Mit Dank an die Agentur Lambsdorff. Mit Dank an Malte Müller, Maria Tragelehn und Renata Serednicka.
Mit Dank an alle, die sich beteiligt haben an dem Projekt.
